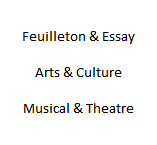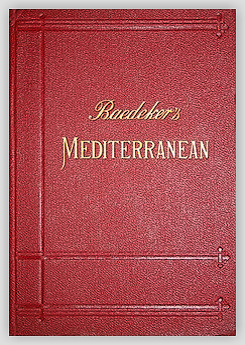|
Als Hilfestellung für die wachsende Zahl der Reisenden kamen in den 1830er Jahren die ersten Reiseführer auf, darunter die später so berühmten, rot eingebundenen von Karl Baedeker. Sie enthielten weniger kunsthistorische Betrachtungen, sondern vor allem praktische Informationen wie Stadtpläne, Abfahrtszeiten und Preise von Eisenbahnen und Fähren, Adressen und Preise von Hotels und Restaurants. Daneben gab es aber auch Hinweise auf lohnende Reiseziele. So empfahl „Reichard’s Passagier”, ein anderer vielgelesener Reiseführer dieser Zeit, die „Rheinfahrt von Mainz bis Coblenz” als „unstreitig die schönste Wasserfahrt, die man in Deutschland machen kann, reich an Naturschönheiten, reich an historischen Erinnerungen und Denkmälern des Mittelalters sind die Ufer rechts und links, bieder und lebensfroh deren Bewohner”. Tatsächlich rollte die erste bürgerliche Reisewelle an den Rhein. Der Strom, der seit der Antike einer der wichtigsten Verkehrswege gewesen war, wurde damit selbst zu einem Reiseziel.
Die Natur und die historischen Orte entlang dem Strom, die efeuumrankten Burgen, die Mythen und Sagen von den Nibelungen bis zur Loreley formten zusammen jene Landschaft, die die Menschen faszinierte. Verstärkt wurde die neue Rheinbegeisterung durch die Romantik, die diese Landschaft vielfach beschrieben und literarisch verklärt hat. Auch auf den Bildern von Malern wie Caspar David Friedrich oder William Turner erschienen die Naturdarstellungen als Schilderung von Seelenstimmungen. Diese Begeisterung zeugt von einem gewandelten Naturverständnis, das Natur zum Gegenstand romantischer Verklärung erhob und sie nicht mehr als bedrohlich erscheinen ließ oder indifferent zum Objekt forscherischen Interesses machte.
Noch Georg Forster hatte die Natur bei seiner Rheinreise im Jahr 1790 mit dem nüchternen Auge des Forschers betrachtet. Er beschrieb die geologischen Formationen des Rheintals, die Beschaffenheit der Böden und die Vegetation. Am später so beliebten Bacharach beklagte er „eine Reihe ärmlicher, verfallener Wohnungen” entlang der Stadtmauer und bemängelte, daß „…die Untätigkeit und die Armut der Einwohner das Widrige jenes Eindrucks vermehrten”.
Die während des gesamten 19. Jahrhunderts anhaltende Italienbegeisterung fand Nahrung in den Reizen der südlichen Landschaft und des milden Klimas. Das „alte Land deutscher Sehnsucht” war immer zugleich auch Goethes „Land, wo die Zitronen blühen”. Schon die ersten Eindrücke am Comer See und in Mailand befreiten Gustav Mevissen 1845 „von ,der düstern Sorge, dem Kind des grauen Nordens‘; er gab sich den Schönheiten der Natur und Kunst freudig hin”, wie es in seiner Biographie heißt.
Der Hamburger Bankier Max von Schinckel schwärmte in seinen Lebenserinnerungen ebenfalls vom Klima und der südlichen Vegetation Italiens, deren Eindruck ihn bei seiner ersten Fahrt über die Alpen 1878 überwältigt hätten.
Von Paris kommend, wo er die Weltausstellung besucht hatte, fuhr er über den Simplonpaß mit der Kutsche nach Italien. In seiner Schilderung erscheint der Alpenkamm als eine Grenze zwischen zwei Welten, den Abstieg vom Paß „im sausenden Trab” beschreibt er als ein Crescendo der Erwartung: „Immer üppiger und südlicher wurde die Vegetation; ganze Wälder von prachtvollen Nußbäumen bedeckten den Südabhang der nach Baveno am Lago Maggiore abfallenden Berge, und als der Blick auf den tiefblauen See sich öffnete und die in voller Blüte stehenden echten Kastanienbäume uns in ihren Schatten aufnahmen und gegen die heiße Sonne schützten, da ging einem das Herz auf, und auch ich empfand das beglückende Gefühl, das denjenigen befällt, der zum erstenmal den Zauber Italiens auf sich wirken läßt.” Im Hotel in Pallanza schließlich erwartete ihn ein „von Orangenduft geschwängerte[r] Garten”, als Abschluß und Höhepunkt dieses Crescendos – der Duft von Orangenblüten, das war der betörende Süden schlechthin.
Auch in Italien galt der Blick der Besucher also der Natur. Die Wärme der südlichen Sonne und die vielbeschriebene Vegetation – Trauben und Feigen, vor allem aber Orangen und Zitronen – bildeten hier den Reiz.
Diese Reaktion auf Landschaft, Vegetation und Klima war wiederum ganz offenkundig von Goethe beeinflußt, der zu Beginn der „Italienischen Reise” die Sehnsucht nach dem Süden in den Appetit auf mediterrane Früchte gekleidet hatte: „Gute Birnen hab ich gespeist; aber ich sehne mich nach Trauben und Feigen.” Die südliche Natur sorgte für Wohlbefinden, minderte Sorgen und Melancholie, stand für „Arkadien”, die Paradieslandschaft schlechthin.
Bei aller Naturbegeisterung fuhr man nach Italien aber doch in erster Linie wegen der Kultur, um Kunst und Architektur der Antike, später allmählich auch die Kunstwerke des Mittelalters im Original selbst zu betrachten. Goethe betrat in Rom eine andere, doch keine ihm gänzlich unbekannte Welt, immerhin hatte er von klein auf durch Bücher, Bilder und die Erzählungen des Vaters viel über Italien und über Rom gehört. Dennoch war er bei seiner Ankunft überwältigt, „denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt”.
Es wurde also nicht in erster Linie sein Wissensdurst gestillt, sondern sein Hunger nach Empfindungen, ausgelöst durch die eigene Anschauung und den persönlichen Eindruck, den die Natur, die Kunst und die Menschen in ihm hervorriefen. Das Wissen war lediglich die Voraussetzung dafür, daß er den Weimarer Freunden schreiben konnte: „Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt; es ist alles wie ich mir’s dachte, und alles neu.”
Wie ihrem Vorbild Goethe war auch den reisenden Bürgern vieles aus dem Schulunterricht, durch Lektüre oder Bilder bereits vertraut. Die Kenntnisse bedurften aber für eine Reise in der Nachfolge des Dichters der Auffrischung. Die intensive Vorbereitung war deshalb Pflicht. Das beherzigte auch Schinckel, der 1899 alle mit seiner Frau gemeinsam unternommenen Reisen durch eine Fahrt nach Rom, Neapel und Sizilien krönen wollte. Vorher lasen die beiden „über die Kunstschätze und über die Geschichte Roms, was wir auftreiben konnten”, und lernten sogar ein wenig Italienisch.
Wenn Deutsche im 19. Jahrhundert nach Italien fuhren, reiste Goethe im Grunde immer mit. Der populäre Schriftsteller Victor Hehn nannte ihn den „Genius, ohne den wir uns die ewige Roma nicht mehr denken können”, und auch bei anderen Italienreisenden findet man immer wieder Bezüge auf den Dichter: Der spätere Präsident des Bundes- und dann seit 1871 des Reichskanzleramtes, Rudolph von Delbrück, unternahm 1863 eine Reise nach Konstantinopel und Griechenland, deren Rückweg über Italien verlief. „So vieles Schöne ich gesehen hatte, Palermo erschien mir als das Schönste”, schrieb er über den Eindruck, den Sizilien auf ihn machte. Nach Berlin zurückgekehrt, schlug er nach, was Goethe über Palermo geschrieben hatte. Und tatsächlich: „In unerreichbarer Darstellung fand ich wieder, was ich selbst empfunden hatte: den Reiz der Natur in See, Fels und Vegetation, den Zauber, welchen die schöne Schläferin, das Marmorbild der heiligen Rosalie, in ihrer phantastischen Kapelle auf dem Monte Pellegrino ausübt…”
Wie seinem Vorbild Goethe ging es auch Delbrück um die Wirkung der Landschaft und der Kunst auf seine Persönlichkeit. „Mir ist jetzt nur um die sinnlichen Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt”, hatte der Dichter in der „Italienischen Reise” geschrieben. Sehr ähnlich formulierte Delbrück über seinen Romaufenthalt 1865: „Das künstlerische, nicht schaffende, aber genießende Auge wurde mir geöffnet. Ich analysierte meine Empfindungen nicht, es war mir genug, daß ich mich niemals und nirgends so glücklich gefühlt hatte, als jetzt in Rom.” Dieses Glücksgefühl führte Delbrück darauf zurück, daß „der Genuß eines Kunstwerkes … die Lebendigkeit des Gemüts steigert und zugleich … unsere Sinne befriedigt und unsere Seele erweitert”.
Bei aller Betonung der je eigenen Gefühle unterschieden sich die Reiseeindrücke Delbrücks, Schinckels oder Gwinners im Grunde nicht fundamental. Es war ihnen aber offenkundig wichtig zu zeigen, daß sie sich neben dem Geschäft den Sinn für Kunst und Ästhetik bewahrt hatten, daß sie empfänglich waren für die Empfindung des Schönen, kurz: Mit ihren Reiseerzählungen demonstrierten sie, daß sie teilhatten an den Werten bürgerlicher Bildung. Der Schilderung von Reiseeindrücken wurde in Biographien und Erinnerungen denn auch recht breiter Raum gegeben. Doch nicht erst für die Lebensbilanz wurden Reiseberichte verfaßt, meist wurden die Erlebnisse bereits während oder direkt im Anschluß an die Reise schreibend oder manchmal, wie im Fall des eingangs angeführten Banklehrlings Gwinner, auch zeichnend verarbeitet. Wenn die Geschäftsleute und Politiker auch in der Regel keine Ambitionen hatten, als Dichter Erfolge zu feiern, orientierten sie sich dabei dennoch an literarischen Vorbildern.
Einen Reisebericht anzufertigen war bereits für humanistische Bildungsreisende ein selbstverständlicher Bestandteil des Unternehmens, und auch im 19. Jahrhundert unterstrich es noch den Charakter des Besonderen einer Reise, eine Reisebeschreibung zu verfassen. Ganz in diesem Sinn war es Mevissen auf Reisen ein „Bedürfnis die Eindrücke, die ich successive aufgenommen, in Worten festzuhalten”.
Die in Briefen und Reiseberichten konservierten Eindrücke und Empfindungen stellten gewissermaßen den Ertrag einer gelungenen Reise dar und lieferten damit den Nachweis, „richtig” gereist zu sein. Daß dies nicht allen Reisenden gelang, beklagte schon Goethe. Er führte seinen Lesern als Negativbeispiel einen Franzosen vor, den er in Venedig getroffen hatte. Es begann damit, daß der Mann kein Italienisch konnte, sein Aufenthalt also schon deshalb eher anstrengend als genußreich war. Vor allem aber spöttelte Goethe über die etwas äußerliche Reisemotivation des Bekannten, der sich im Grunde für nichts recht interessiert habe. „Er reist durch Italien bequem, aber geschwind, um es doch einmal gesehen zu haben. In Gedanken aber ist er nur bei seinem Sohn daheim.” Das Urteil des Dichters fällt eindeutig aus: „Ich betrachte mit Erstaunen, wie man reisen kann, ohne etwas außer sich gewahr zu werden, und er ist in seiner Art ein recht gebildeter, wackrer, ordentlicher Mann.”
Auch diese Ermahnung hatte Schinckel verinnerlicht. Eine Florenzreise, die der Bankier 1882 gemeinsam mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar unternahm, beurteilte er denn auch nach diesem Maßstab als nicht gelungen: Seine Frau und er mußten „nach einem Plan, den Herr Garlieb Amsinck aufgestellt hatte, innerhalb acht Tagen alle Sehenswürdigkeiten von Florenz besichtigen. Ich muß gestehen, daß ich schließlich gar nicht mehr wußte, in welchen Kirchen und Galerien ich gewesen war. Erst ein späterer, nochmaliger Besuch hat mir zu bleibendem Genuß an den Florentiner Kunstschätzen verholfen.”
Flüchtiges Reisen galt auch im 19. Jahrhundert noch als einer der größten Fehler. „Das Durchfliegen ist die gewöhnlichste, theuerste und unnützeste Art zu reisen. Viel Post gefahren, weiter nichts”, hieß es beispielsweise in dem weitverbreiteten Reiseführer „Reichard’s Passagier”.
Wie lange man konkret brauchte, um nicht „flüchtig” zu reisen, war damit allerdings nicht gesagt. Victor Hehn bezeichnete noch in den 1890er Jahren ein Jahr als das Minimum für eine Italienreise. Deshalb brachten ihn die „behaglichen Eheleute” auf, die „Rittergutsbesitzer im Moment, wo keine dringende Arbeit vorliegt, Kaufleute in der Zwischenzeit, wo der Handel ruht, Rentiers, die die lange Weile plagt”. „Wer auch nur vier oder sechs Wochen frei hat, … wer ein Sümmchen erspart hat und sich dafür in der weiten Welt umthun und auch einmal fremde Gesichter sehen will, der macht einen Ausflug nach Neapel und ist am richtigen Tage wieder daheim bei den lieben Seinigen und Abends am Stammtische”, höhnte er. Er hielt das Reisen für eine Kulturübung, und zwar eine so exklusive, daß nur ein kleiner Kreis würdig sei, diese Kunst auszuüben.
Natürlich ließen sich von solchen Donnerworten nur wenige von ihren Reiseplänen abbringen. Im Gegenteil nahm die Zahl der Reisenden stetig zu. Und damit wuchs die Kritik an ungebildeten Parvenüs, die das Reisen insgesamt entwerteten. „Diese braven Leute, die als große ‚Familie Piefke‘ die Gestade der Riviera und Siziliens überschwemmen, ahnen nicht, daß wahre Bildung mit Bescheidenheit und Zurückhaltung des Urteils beginnt, mit ruhiger Achtung und Aufgeschlossenheit allem Fremdartigen gegenübertritt und schließlich in Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen gipfelt”, wetterte 1914 der Historiker Friedrich Meinecke. Es sei „eine Qual für feiner fühlende Deutsche, ihre Nation im Auslande von diesen lärmenden und geschmacklosen Emporkömmlingen diskreditiert zu sehen”.
Mit freundlicher Genehmigung von: Barbara Wolbring in: DAMALS, Nr. 7/1999, S. 98ff. Barbara Wolbring, geb.1965 hat Geschichte und Germanistik studiert. Sie ist wiss. Assistentin am Historischen Seminar der Universität Frankfurt am Main.
|