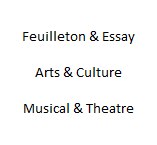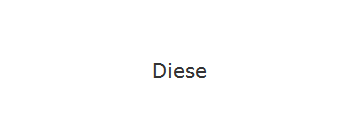|
Die durchschnittliche gemeinsame Lebenszeit von Großeltern und Enkeln hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verlängert, was vor allem auf eine höhere Lebenserwartung zurückzuführen ist. Vor 1950 hatte die Mehrheit der Zehnjährigen keine lebenden Großeltern mehr, Anfang der 90er Jahre hatten dagegen über 80 Prozent der 10- bis 14jährigen noch Großeltern (Lange&Lauterbach, 1998). Die gemein- same Lebenszeit wird sich in Zukunft vermutlich nicht weiter erhöhen, weil der steigenden Lebens- erwartung ein steigendes Erstgeburtsalter der Mütter entgegenwirkt.
Das hohe Erstgeburtsalter wird sich künftig in mehreren aufeinander folgenden Generationen auswirken und dürfte so zu einer "Alterslückenstruktur" in der Bevölkerung führen (Bundesministerium für Familie, Senioren und Gesundheit).
Bewertung von Großelternschaft: Der Einfluss von Großeltern auf Enkelkinder wurde bis vor einigen Jahrzehnten als ungünstig eingeschätzt (Smith,1991). Großeltern wurden entweder als zu nachsichtig und verwöhnend oder aber, ganz entgegengesetzt, als zu altmodisch und streng beurteilt. Heute dagegen wird Großelternschaft von vielen Seiten positiv beurteil: Etwa 90 Prozent der von Herlyn et al. (1998) in einer großen, repräsentativ angelegten Studie befragten Großmütter empfanden Freude, Stolz und Bereicherung durch ihre Enkel. Die Enkel gaben den Frauen das Gefühl, jung zu bleiben und gebraucht zu werden. Mehr als 70 Prozent fanden das Großmuttersein sogar schöner als das Muttersein, vor allem weil die Begegnungen mit den Enkeln ohne die elterliche Erziehungsverantwortung genossen werden konnte.
Konflikte um Erziehungsfragen zwischen Großeltern und Eltern traten nur vereinzelt auf. Manche Forscher sprechen gar von einem Gesetz der Nichteinmischung, wonach von Großeltern erwartet wird, sich bei schwierigen Erziehungsfragen aus den Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern herauszuhalten (zusammenfassend bei Uhlendorff, 2003). Auch wenn man die Einbindung älterer Menschen in ihre sozialen Netzwerke betrachtet, ist die positive Bewertung von Großelternschaft gut nachvollziehbar: Die sozialen Netzwerke älterer Menschen werden im Laufe der Jahre tendenziell kleiner und stärker verwandtschaftsorientiert, denn im höheren Alter sind einige der gleichaltrigen Freunde und Bekannte bereits verstorben. Gleichzeitig konzentrieren sich alte Menschen immer mehr auf emotional hoch bedeutsame Beziehungen (Lang&Baltes, 1997) Enkelkinder gehören zu den wenigen neu hinzukommenden und gleichzeitig emotional hoch bedeutsamen Personen im Netzwerk älterer Menschen und dürften auch deshalb eine so große und positiv bewertete Rolle im Leben der Großeltern spielen.
Auch aus Sicht der Enkel wird Großelternschaft positiv erlebt. Zwischen 80 und 90 Prozent der von Höpflinger et al. (2006) befragten Enkel beschreiben ihre Großeltern als liebevoll, großzügig und gesellig. Die Enkel wissen zu schätzen, dass die Großeltern verlässlich sind und, wenn nötig, viel Zeit für sie haben.
Dieser Aufsatz ist auf der Grundlage eines Vortrages entstanden, den der Autor bei der Tagung "Jugendkultur Altenkulturfachtag für generationenverbindende Kulturarbeit", veranstaltet von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bonn) und dem Projektebüro "Dialog der Generationen" (Berlin), am 22. Juni 2007 in Leipzig-Grünau gehalten hat.
Auch aus wissenschaftlicher Sicht wird Großelternschaft heute günstig beurteilt, insbesondere durch die Entwicklungspotenziale, die sich sowohl für Enkel als auch für Großeltern aus der Beziehung ergeben: Kinder stehen vor den Aufgaben vertrauensvolle Beziehungen zu zentralen Bezugspersonen zu entwickeln und anschließend die außerfamiliale Welt selbstbewusst zu erobern (angelehnt an das Entwicklungsmodell von E.H.Erikson). Krappmann (1997) beschreibt, wie Großeltern ihre Enkelkinder im Vor- und Grundschulalter bei der Lösung dieser Entwicklungsaufgabe unterstützen können. Danach sind "Großeltern wegen ihrer Vertrautheit mit dem Kind und der dennoch spürbaren Verschiedenheit von den Eltern in besonderer Weise geeignet, die Kinder vor die Aufgabe zu stellen, ihre ersten sozialen Fähigkeiten unter leicht veränderten Bedingungen anzuwenden.
Gemeinsame Unternehmungen von Großeltern und Enkeln können als Schritte in die Welt jenseits der Grenzen der Kernfamilie betrachtet werden." Zu den sog. Entwicklungsaufgabe n des Alters gehört neben der Akzeptanz biologischer Veränderungen auch die Ausübung der Generativität. Unter Generativität ist die Vermittlung von Erfahrungen und Kompetenzen an jüngere Generationen zu verstehen, z.B. als Großeltern oder auch außerhalb der Familie (Uhlendorff, im Druck). Generativität gegenüber Jüngeren bietet der älteren Generation eine Möglichkeit hoch sinnvoll erlebte Aktivitäten zu entfalten und dabei "eine Spur zu hinterlassen, die über den eigenen Tod hinaus Bestand hat" (Kessler&Staudinger, im Druck; Lang&Baltes, 1997). Lebendige und anregende Großeltern-Enkel- Beziehungen setzen allerdings eine gute körperliche und psychische Gesundheit bei der älteren Generation voraus (Höpflinger et al., 2006). Ambivalente oder sogar negative Bewertungen von Großelternschaft kommen heute nur noch sehr selten vor. Die in der Fachliteratur beschriebenen Einzelfälle beziehen sich auf Familien, die schwierige Lebenslagen zu bewältigen haben, wodurch auch die Großeltern Enkel- Beziehung überschattet wird. Einige Studien zeigen, dass Großelternschaft als belastend erlebt wird, wenn die Großeltern die volle Erziehungsverantwortung für ihre Enkel übernehmen müssen (z.B. Glass& Huneycutt,2002),z. B. weil die mittlere Generation wegen Kriminalität, Drogenmissbrauch oder schwerer Krankheit ausfällt.
Eine andere Grenze der positiven Bewertung von Großelternschaft zeigt Wieners (2005) bei ihrer Befragung von Heimkindern. Manche dieser Kinder lehnen ihre Großeltern aus subjektiv nachvollziehbaren Gründen eindeutig ab, aber auch bei den Heimkindern ist eine gute Beziehung zu den Großeltern die Regel.
Auf der Grundlage familienhistorischer Betrachtungen wird bei Höpflinger et al.(2006) die Entwicklung der Großelternrolle kritisch diskutiert. Die Autoren vergleichen dazu die heutige, in ihren Augen manchmal idealisierte Einschätzung von Großelternschaft mit früheren Sichtweisen. Danach ging die Entwicklung zur heutigen Großelternrolle mit einer "Entmachtung älterer Menschen innerhalb des familialen Autoritätsgefüges" einher, so wurde z.B. der "Großvater als Lehrmeister" vom "Großvater als Märchenerzähler" verdrängt.
Wohnentfernung, Enkelbetreuung, Gesprächsthemen: Nur wenige Großeltern leben heute gemeinsam mit ihren Kindern und den Enkel in einem gemeinsamen Haushalt (Hoff, 2006), dennoch wohnen etwa 80 Prozent der Enkel mit ihren Großeltern am selben Ort oder sind innerhalb einer Stunde Fahrzeit erreichbar (Lange & Lauterbach, 1998). Nach Angaben von Enkeln im Jugendalter haben mehr als 80 Prozent 3 von ihnen mindestens gelegentlichen Kontakt zu den Großeltern (Schneekloth,2006). Trotz getrennter Haushalte kann also nicht von einer Isolierung der Familiengenerationen gesprochen werden. Eine höhere Schulbildung bei der mittleren Generation und auch attraktive Arbeitsmöglichkeiten in weit entfernten Großstädten führen allerdings oftmals zu einer größeren Wohnentfernung zwischen Großeltern und Enkelkindern (Lange & Lauterbach, 1998). Große Wohnentfernungen erhöhen eindeutig die Entfremdungsgefahr, während finanzielle Unterstützungsleistungen und auch die Aussicht auf eine Erbschaft mit intensiveren intergenerationalen Kontakten einhergehen (Szydlik, 2002). Ausführlicher werden diese Themenbereiche bei Uhlendorff (2003) entfaltet.
Viele Großeltern sind in die Betreuung ihrer Enkel involviert. Etwa 45 Prozent der 5-bis 6jährigen werden, in der Regel neben dem Kindergarten, von den Großeltern betreut. Weitere Betreuungspersonen wie andere Verwandte, Freunde der Eltern oder Tagesmütter spielen im Vergleich zu Großeltern eine nachgeordnete Rolle (Alt, Blanke & Joos, 2005). Das Engagement von Großmüttern für die Enkelbetreuung ist unabhängig von ihrer eigenen Erwerbstätigkeit (Templeton & Bauerreis, 1994), d.h. berufstätige Großmütter betreuen ihre Enkel genauso häufig wie nicht berufstätige Großmütter. Anscheinend schränken die berufstätigen Großmütter eher andere Aktivitäten ein als die Betreuung der Enkel. Großmütter mütterlicherseits engagieren sich stärker bei der Enkelbetreuung als Großmütter väterlicherseits und als Großväter (Höpflinger et al. 2006). Das mag daran liegen, das s sich Mütter bei Kinderbetreuungsbedarf zunächst an die ihnen am nächsten stehenden Personen wenden, das sind oft die eigenen Mütter. Andere Autoren vertreten eine evolutionstheoretische Sicht, wonach die Großmutter mütterlicherseits am meisten in die Beziehung investiert, weil sie sich der Verwandtschaft zum Enkelkind besonders sicher sein kann (These der Vaterschaftsunsicherheit; z.B. Beise, 2006; Euler & Weitzel, 1996).
Die Qualität von Großvaterschaft gegenüber Enkeln im frühen Jugendalter scheint stark in der gemeinsamen Geschichte der Großvater-Enkelkind-Beziehung verankert zu sein (Höpflinger et al., 2006): Je mehr sich die Großväter in früheren Jahren um das Enkelkind bemüht haben, desto wichtiger und bedeutender ist die Beziehung heute für Großväter und für Enkel. Für Großmütter und Enkel ist dieser Zusammenhang nicht so eindeutig. Die Autoren führen das u.a. darauf zurück, dass traditioneller Weise die Mithilfe bei der Säuglings- und Kleinkindbetreuung zur Großmutterschaft gehört, und "wenn Großmütter generell stärke r bei der Kinderbetreuung aktiv sind, wird damit auch der Effekt auf das spätere Verhalten geringer. Bei Großvätern fehlt diese sozial-normative Selbstverständlichkeit, und aktives großväterliches Engagement ist stärker eine individuell zu konstruierende Realität. ... Sie müssen ihr großväterliches Engagement selbst entwickeln, und je früher es ihnen gelingt, desto besser sind die Chancen für eine positive intergene wie rationale Beziehung auch gegenüber heranwachsenden Enkelkindern."
Während zwischen Großeltern und jugendliche Enkeln relativ viel über die Schule oder über soziomoralische Fragen gesprochen wird, gibt es Themen, die von beiden Seiten klar gemieden werden (Höpflinger et al., 2006), nämlich die Bereiche Verliebtheit der Jugendlichen, körperlich intime Aspekte und "Geheimnisse" wie Rauchen, Alkoholkonsum und Stehlen. Diese Themen sind vermutlich für gleichaltrige Freunde reserviert. Die Autoren betonen, dass bei guten Beziehungen zwischen jugendlichen Enkeln und ihren Großeltern wichtige Intimitätsschranken von beiden Seiten eindeutig respektiert werden.
Trennungen in der Elterngeneration: Trennungen oder Scheidungen bei der mittleren Generation stellen die Familien vor aufreibende Aufgaben. Manchmal können Großeltern für ihre Enkel wichtige Ansprechpartner während des Trennungsprozesses sein (Dusolt, 2004; Lussier et al., 2002) und auf diese Weise Stabilität und sichere Bindung bieten, gerade wenn die Mütter und Väter durch das Trennungsgeschehen emotional überbelastet sind. Durch Trennungen bei der Elterngeneration kann die Großeltern-Enkel-Beziehung allerdings auch ernsthaft gefährdet werden. Lebt der Enkel bei der Mutter, berichten Großeltern väterlicherseits nach der Trennung oftmals von einem verringerten Kontakt zum Enkel (Fthenakis, 1998). Wenn Mütter das alleinige Sorgerecht haben, ist der Kontakt zu den Großeltern väterlicherseits noch eingeschränkter. Je jünger die Kinder bei der Trennung sind, desto mehr wird das Verhältnis zu den Großeltern belastet, vermutlich weil bei jüngeren Kindern die Beziehung zu den Großeltern noch durch die mittlere Generation gebahnt und gestützt werden muss (Cooney & Smith,1996).Wenn nach einer Trennung oder Scheidung neue Partnerbindungen bei der mittleren Generation entstehen, ändert sich die Situation für die Großeltern noch einmal (Lussier et al., 2002). Das Familiensystem wandelt sich durch neu hinzukommende Partner und Stiefgroßeltern und zwar nicht selten zuungunsten der Großeltern väterlicherseits. Stiefgroßelternschaft entsteht oftmals erst nach der frühen Kindheit der Enkel, dadurch sind die Bindungen zwischen Stiefgroßeltern und ihren Enkeln weniger intensiv (Fthenakis, 1998). Dennoch gibt es viele Beispiele sehr enger Stiefgroßeltern-Enkel-Beziehungen. Politisch setzt sich zurzeit die "Großelterninitiative"
(www.grosseltern-initiative.de) für die Besuchsrechte von Großeltern nach Trennungen ein.
Abschließend möchte ich auf weiterführende Informationsangebote für Großeltern hinweisen. Adelheid Müller- Lissner bietet mit ihrem Buch "Enkelkinder" (2006) eine facettenreiche und lebendig geschriebene "Orientierungshilfe für Großeltern" an. Daneben soll ein nachahmenswertes Konzept der Großelternweiterbildung vorgestellt werden, das die Volkshochschule Brandenburg mit Unterstützung des Landes Brandenburg entwickelt hat, um die Kompetenzen von Großeltern zu stärken ("Großeltern in der Familienbildung", Volkhochschule Brandenburg an der Havel, 2006):
Nachdem die eigenen Anliegen und Ziele der teilnehmenden Senioren thematisiert und geklärt werden, liegt der Schwerpunkt der mehrwöchigen Weiterbildung auf der Vermittlung entwicklungspsychologischen Praxiswissens, das nach den Bedürfnissen der Enkel, abhängig von ihrem Alter, geordnet wird. Zum Ende der Weiterbildung öffnet sich der Blick über die eigene Familie hinaus. Dazu wird die Lebenssituation von anderen Familien am Ort beleuchtet und sinnvolle Möglichkeiten mitbürgerlichen Engagements werden erarbeitet. Insgesamt ist in Brandenburg ein Projekt erarbeitet worden, bei dem die Senioren eigene Ressourcen entdecken, weiterentwickeln und in der Folgezeit auch einsetzen können und das den intergenerationalen Dialog zwischen Alt und Jung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie fördert.
|